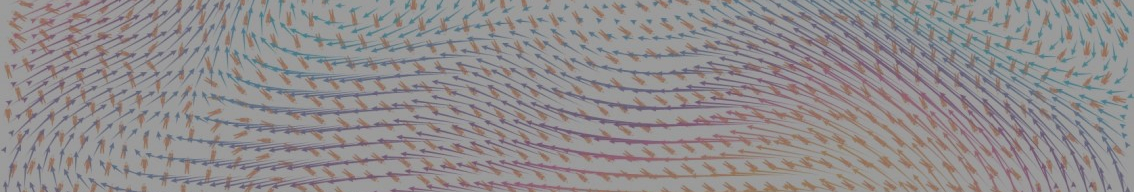23. September 2020 (10:00 - 13:00)
### SekMuG2: Sektion Medizin- und Gesundheitssoziologie: Soziale Ungleichheit und Gesundheit in Modernen Wohlfahrtsstaaten. Aktuelle soziologische Beiträge an der Schnittstelle von Gesundheits- und Sozialpolitikforschung
- _Chair der Sitzung:_ **Katja Möhring**, Universität Mannheim
- _Chair der Sitzung:_ **Nadine Reibling**, Universität Siegen
_Ort:_ **digital**
Den Link zur digitalen Sitzung finden Sie nach Anmeldung zum Kongress bei Eventbrite.
### Präsentationen
**Helping Helpers: The Role of Monetary Transfers in Combining Informal Care and Work**
**Klara Raiber, Mark Visser, Ellen Verbakel**
Radboud University Nijmegen, Niederlande
_Discussant: Dina Frommert_
Caring for a friend or family member in need of care is time-consuming and stands in conflict with labor force participation. One idea to help informal caregivers, which is often supported by policies such as the long-term insurance in Germany, is to compensate them with monetary transfers so that they can reduce work hours or (temporarily) exit employment. Although financial transfers may offer relief in terms of the experienced pressure, employment reductions may worsen caregivers’ positions in the long-run. Monetary transfers provoke tensions between the idea of helping the informal caregiver and negative labor market outcomes for the informal caregivers. We study if monetary transfers indeed give an incentive to reduce labor supply. When looking at the underlying mechanism of monetary transfers, it is important to acknowledge differences between females and males. With a rising demand for informal caregivers, the inequalities between females and males in the labor market could be exacerbated. Therefore, it is even more interesting to compare the influence of monetary transfers for females and males because it might affect the gender gaps.
We contribute to the existing literature by not only looking at care within the household but by additionally including caregiving relationships where the person in need and the caregiver can live in different households. Previous studies lack the information if the caregivers actually receive the cash. We overcome this issue by concentrating on the monetary transfers that caregivers report they get for their effort. By looking at the actual received amount of money for caregiving, we come closer to understand the actual mechanism of monetary transfers.
To answer our research questions we use waves 2 to 12 (2007-2018) of the German panel study ‘Labour Market and Social Security (PASS)’. By using fixed-effects panel models we find that a change towards intensive caregiving reduces working hours and increases the likelihood to become non-employed. Only for women, starting to receive monetary transfers reduces working hours and at the same time stopping to receive monetary transfers increases working hours. There is no statistical evidence that the effects of care, as well as monetary transfers for care, are different for females and males.
--------
**Ungleichheiten in Gesundheit und Wohlbefinden in Europas älterer Bevölkerung: Materielle Ressourcen und Mechanismen der sozialen Sicherung**
**Alina Schmitz, Martina Brandt, Claudius Garten**
TU Dortmund, Deutschland
_Discussant: Nora Lämmel_
Angesichts der demografischen Entwicklung, wachsender sozialer Ungleichheiten und einem allgemeinen Rückzug des Wohlfahrtsstaats in vielen europäischen Ländern stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Gesundheit und ein hohes Wohlbefinden im Alter möglich sind. Sowohl im Vergleich der europäischen Länder als auch innerhalb der einzelnen Staaten zeigen sich deutlich ausgeprägte Ungleichheiten in Gesundheit und Wohlbefinden der älteren Bevölkerung, die sozialpolitischen Handlungsbedarf deutlich machen. Die Folgen alterstypischer Lebensrisiken für Gesundheit und Wohlbefinden können durch die Verfügbarkeit materieller Ressourcen sowie soziale Sicherungsmechanismen und ein ausreichend großes Angebot von Versorgungsangeboten minimiert werden, da dann mehr und besser auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene gesundheitliche Versorgungsangebote in Anspruch genommen werden können.
Auf der Grundlage der sechsten Welle des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) aus dem Jahr 2015 untersuchen wir anhand von Mehrebenen-Modellen den Einfluss von materiellen Ressourcen und Mechanismen der sozialen Sicherung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung 50+. Neben verschiedenen Ländern Nord- , West- und Südeuropas können damit auch verschiedene Länder Osteuropas berücksichtigt werden, wo bislang kaum Erkenntnisse zu Gesundheit und Wohlbefinden der älteren Bevölkerung vorliegen. Neben dem Ländervergleich liegt ein Fokus auf regionalen Unterschieden bei der Verfügbarkeit von Versorgungsangeboten im Pflege- und Gesundheitsbereich innerhalb der einzelnen Länder.
Erste Analysen zeigen, dass Variationen in Gesundheit und Wohlbefinden der älteren Bevölkerung wesentlich durch soziale Ungleichheiten in der Verfügbarkeit von materiellen Ressourcen erklärt werden können. Neben individueller sozialer Ungleichheit spielt auch die Verfügbarkeit sozialer Sicherungsmechanismen (z.B. Pflegeleistungen für pflegebedürftige Ältere, gesundheitliche Versorgungsangebote) eine Rolle. Es lässt sich schlussfolgern, dass sozialstaatliche „Auffangmechanismen“, die im Falle von alterstypischen Lebensrisiken wie Pflegebedarf oder Krankheit (Angehöriger) wirksam werden, einen eigenständigen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden im Alter leisten.
---------
**Vorgeschichte, Leistungsfall und Lebenssituation - Das Erwerbsminderungsgeschehen als sozial- und gesundheitspolitisches Handlungsfeld**
**Dina Frommert**
DRV Bund, Deutschland
_Discussant: Klara Raiber_
Im Fall der Erwerbsminderung wird das Zusammenspiel von Sozialpolitik und Gesundheitsfragen besonders deutlich. Einerseits ergibt sich eine Erwerbsminderung meist als Endpunkt einer längeren gesundheitlichen Entwicklung, andererseits wird von Seiten der Sozialpolitik an mehreren Stellen versucht Einfluss zu nehmen. Die auskömmliche Absicherung und die Lebenssituation im Fall einer Erwerbsminderung sind originäres Ziel und Objekt sozialpolitischer Gestaltung.
In der Studie „Lebensverläufe und Altersvorsorge“ (LeA) wurden für die Geburtsjahrgänge 1957-1976 An-gaben zu den Erwerbsverläufen und der Altersvorsorge erhoben. Die monatsgenauen Längsschnittdaten zu den Erwerbsverläufen sind besonders valide, da die retrospektiven Befragungsdaten mit administrativen Daten der Rentenversicherung individuell gekoppelt wurden. Aus der Befragung liegen Angaben zur Absicherung in allen Alterssicherungssystemen vor. Zusätzlich wurden Informationen zum Gesundheitszustand, zur Inanspruchnahme von Reha-Leistungen und ggf. dem Erwerbsminderungsstatus erfragt.
Der angebotene Beitrag untersucht auf Basis der LeA-Daten insbesondere geschlechterspezifische Ungleichheiten, da sich auf diesem Feld persistente Unterschiede und interessante aktuelle Entwicklungen zeigen. So ist belegt, dass sich Männer und Frauen in den Diagnosen unterscheiden, die einer Erwerbsminderungsrente zugrunde liegen. Sie weisen aber auch eine unterschiedliche Vorgeschichte in den Erwerbsverläufen und in der Rehabilitation auf. Während Männer früher häufiger von Erwerbsminderung betroffen waren, so hat sich dieser Trend in den letzten Jahren umgekehrt. Der Anteil der erwerbsgeminderten Frauen ist aktuell größer als der der erwerbsgeminderten Männer.
Sozialpolitisch werden Handlungsfelder in verschiedenen Bereichen aufgezeigt. Sie betreffen den Arbeits-markt, aber auch die gesetzliche Rentenversicherung als Träger von Rehabilitation und die Alterssicherung im Mehrsäulensystem, das gerade für die typisch verkürzten Erwerbsverläufe von Erwerbsgeminderten noch keine Lösung bietet.
-------------
**Interessenvertretung in der Pflege – zu komplex um Arbeitsbedingungen mitzugestalten?**
**Nora Lämmel, Isabelle Riedlinger, Karin Reiber**
Hochschule Esslingen, Deutschland
_Discussant: Alina Schmitz_
Der wachsende Fachkräftemangel in der Pflege bei gleichzeitiger Zunahme von Pflegebedürftigen ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ganz oben auf der politischen Agenda und erstreckt sich über die Gesundheitspolitik hinaus in andere Politikfelder. Spätestens die „Konzertierte Aktion Pflege“ (KAP) verweist auf Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ressorts. Dieses gemeinsame Vorgehen verdeutlicht die Bedeutsamkeit der als „systemrelevant“ beschriebenen Berufsgruppe und die Komplexität des Handlungsfeldes.
Somit ist es umso erstaunlicher, dass Pflegekräfte selbst nicht viel häufiger für ihre originären Interessen eintreten, wie beispielsweise für bessere Arbeitszeiten. Unser Datenmaterial des Forschungsverbundes ZAFH care4care zeigt zum Beispiel, dass Leitungskräfte nach Innen und Außen eine starke Arbeitnehmer*innenorientierung propagieren, die allerdings auf der Prozess- und Mitarbeiter*innenebene oftmals nicht erkennbar umgesetzt wird. Gleichwohl unterschätzen Pflegefachkräfte die Möglichkeiten eigener Interessenvertretung – auch wenn es darum geht Arbeitszeitmodelle mitzugestalten – und damit das Potenzial eines konzertierten Auftretens als Berufsgruppe. Auch wenn in der KAP eine Verpflichtung zu arbeitnehmer*innenfreundlichen Arbeitszeitmodellen beschlossen wurde, zeigt sich, dass dies nur z. B. durch die Mitwirkung der Einrichtungen und ihrer Verbände von statten gehen kann – auch wenn die Leitungskräfte diesbezüglich Unterstützung von verschiedenen Akteursgruppen fordern. Diese Konfliktlinien deuten darauf hin, dass zwar Räume der Aushandlung genutzt werden können, die aber für die Mehrheit der Fachkräfte nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.
In unserem Beitrag möchten wir anhand der Daten einer dreistufigen onlinegestützten Delphi-Befragung, die im Rahmen des Verbundprojekts ZAFH care4care durchgeführt wurde, ergänzt durch Befunde aus Expert*innen-Interviews und multiperspektivischen fokussierten Betriebsfallstudien das Thema Interessenvertretung am Beispiel Arbeitszeitgestaltung und damit einhergehende Spannungsverhältnisse im Kontext aktueller politischer Debatten beleuchten. Im Zuge dessen sollen Möglichkeiten einer wirksam organisierten Interessenvertretung der beruflich Pflegenden zur Mitgestaltung ihrer Arbeitsbedingungen diskutiert werden.
--------------
**“Business as usual”, “career changer” oder “career killer”? Die Auswirkungen von diagnostizierten Erkrankungen auf den Erwerbs- und Einkommensverlauf in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Abhängigkeit**
**Andreas Jansen**
Universität Duisburg-Essen
_Discussant: Dina Frommert_
Im Rahmen des Vortrages werden die Auswirkungen einer erstmalig diagnostizierten Erkrankung auf den Erwerbsstatus sowie die Entwicklung des individuellen Erwerbseinkommens in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Klassenzugehörigkeit der Individuen untersucht. In der Analyse wird zwischen chronischen Erkrankungen, bei denen eine Verschlechterung der Gesundheit in der Regel nicht unmittelbar eintritt (z.B. Asthma, Diabetes, chronische Muskel- und Skeletterkrankungen) und Erkrankungen, die gemeinhin zu einer direkten Verschlechterung des Gesundheitszustands führen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankung), unterschieden. Während bei ersteren Erkrankungen vornehmlich längerfristige Auswirkungen der Erkrankung auf den Erwerbs- und Einkommensverlauf zu erwarten sind, ist bei Letzteren zu prüfen, ob sich die Erwerbsbeteiligung nach einer Regenerationsphase wieder dem Ursprungsniveau annähert oder nicht. Aus sozialpolitischer Perspektive ist ein tiefergehendes Verständnis über längerfristige Erwerbseinkommenseffekte von Erkrankungen aufgrund der damit verbundenen sozialen Sicherungsprobleme in den äquivalenzbasierten Sozialversicherungssystemen von Bedeutung. So kann eine Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit des Haushalts (und somit des Haushaltser-werbs-einkommens) aufgrund einer längerfristigen oder chronischen Erkrankung eines Haushaltsmitgliedes nicht nur negative Folgen für den jeweils aktuellen Lebensstandard haben, sondern langfristig auch das Altersarmutsrisiko erhöhen – zumindest dann, wenn keine adäquate Anpassungsreaktion des Haushaltes erfolgt bzw. erfolgen kann. Die Analyse findet auf Basis der SHARE-RV Daten statt. Neben einer detaillierten Erhebung des Gesundheitszustandes sowie der Gesundheitshistorik in der SHARE-Befragung, wird die Erwerbsbiographie der Befragungspersonen aufgrund des Rückgriffs auf die Versichertenkontenstichprobe der Deutschen Rentenversicherung weitgehend lückenlos erfasst. Dies erlaubt, auch für bereits ver-rentete Personen den Einfluss diagnostizierter Erkrankungen auf Erwerbs- und Einkommensverlauf zu analysieren. In der deskriptiven Analyse werden dazu Sequenzmusteranalysen verwendet, in deren Rahmen es möglich ist, die Verknüpfung einzelner Statuszustände sowie die zeitliche Abfolge von Status zu untersuchen. Für die multivariate Längsschnittanalyse wird die Fixed Effects Panelregression genutzt.
[Raiber et al_2020_DGS.pdf](file-guid:a665b9f4-bba3-48e5-abb1-0cb8d0984246)
[Frommert_DGS_EM.pdf](file-guid:047f587a-93ef-4c52-9d2b-8d4f30cc06c8)
[DGS-AgeWell.pdf](file-guid:7a1424c4-da6a-498a-bd01-e4884be04824)
[Präsentation DGS_Lämmel_Riedlinger_Reiber.pdf](file-guid:4c001c4c-b96c-4909-af82-b088343f55b6)