21. September 2020 (13:30 - 16:30)
### Ad Hoc118: Die Sprache der Gesellschaft
- _Chair der Sitzung:_ **Hubert Knoblauch**, Technische Universität Berlin
- _Chair der Sitzung:_ **Silke Steets**, FAU Erlangen-Nürnberg
_Ort:_ **digital**
Den Link zur digitalen Sitzung finden Sie nach Anmeldung zum Kongress bei Eventbrite.
### Präsentationen
**Die Objektivation der Sprache**
**Hubert Knoblauch** [1], **Silke Steets** [2]
(1) Technische Universität Berlin, Deutschland; (2) Friedrich-Alexander Universität Erlangen
Nach dem „linguistic turn“ nahm die Sprache eine bedeutende Rolle in der Soziologie ein. Lag der Schwerpunkt der Forschung zunächst auf dem Verhältnis von Sprache, Institutionen und sozialer Un-gleichheit, rückte später verstärkt das sprachliche Handeln in den Blick. So bildete die Sprachsozio-logie eine der wichtigsten Säulen sowohl der theoretischen (Berger/Luckmann oder Habermas) als auch der empirischen Soziologie (Oevermann, Soeffner); darüber hinaus kam es zu erfolgreichen Ko-operationen mit der Soziolinguistik. Im Zuge dieser Fokussierung auf Sprache, sprachliches Handeln und sprachvermittelte Interaktionen wurde allerdings zunehmend die Vernachlässigung der nicht-sprachlichen Kommunikation bemerkt, was zur intensiven empirischen und theoretischen Erforschung nichtsprachlichen kommunikativen Handelns führte – etwa im Rahmen des kommunikativen Konstruk-tivismus, der Praxistheorien oder der neuen Materialismen. Während diese Ausweitungen empirisch, methodologisch und theoretisch enorm fruchtbar waren, ist indessen die sprachsoziologische For-schung (nicht nur) im deutschsprachigen Raum nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Zwar gibt es noch einige Aktivitäten in der Linguistik und der stark linguistisch dominierten konversationsanaly-tischen Gesprächsforschung, doch wird die gegenwärtige Soziologie der gesellschaftlichen Rolle und Bedeutung der Sprache nicht mehr gerecht.
So notwendig wir die Betrachtung der Sprache als eines Prozesses ansehen, der in Handeln und In-teraktion eingebettet ist, so wichtig erscheint es uns, die Objektivität der Sprache in einer neuen Wei-se zu betrachten, die erst mit der Frage der Materialität wieder in den Blick gerückt ist. Dazu gehören etwa die Folgen der digitalen Mediatisierung, für die Sprache ja nach wie vor ein bedeutendes Zei-chensystem darstellt, das ‚Medium‘ der neuen Medien wie auch deren Objekt ist, die nicht mehr an menschliche Handlungen gebunden ist. Auf dieser allgemeinen Grundlage möchten wir in diesem Vortrag Überlegungen zu einer neuen Sprachsoziologie anstellen.
-----------
**Die kommunikative Verfertigung von Zukunft in projektiven Gattungen**
**Ruth Ayaß**
Universität Bielefeld, Deutschland
Der Vortrag stellt ein aktuelles Forschungsprojekt der Sprachsoziologie vor (gefördert von der DFG), das sich 'projektiven Gattungen' der alltäglichen Kommunikation widmet und in seiner Anfangsphase befindet. Das Forschungsvorhaben knüpft an die sprachsoziologischen Gattungsforschungen von Thomas Luckmann und Jörg Bergmann über rekonstruktive Gattungen und Gattungen der Moralkommunikation an. Der Vortrag konzentriert sich auf die methodischen und theoretischen Perspektiven der Gattungsforschung.
Unter projektiven Gattungen werden verfestigte Formen von Kommunikation verstanden, mit denen im Alltag über Zukunft gesprochen wird. In projektiven Gattungen wird Zukunft im weitesten Sinn kommunikativ bearbeitet. Sie bilden Formen des Sprechens über künftige Handlungen in alltäglichen Kontexten, also kommunikative Formen, mit denen Interagierende im Alltag ihre Handlungen vorbereiten, absprechen, planen etc. Unter der Gattungsfamilie der projektiven Gattungen wird das Gesamt der Formen verstanden werden, die den Interagierenden zur Verfügung stehen, um ihre Zukunft kommunikativ zu verfertigen. Im Unterschied zur bisherigen Gattungsforschung wird ein längsschnittliches Forschungsdesign angelegt, das die beobachteten Akteure über einen längeren Zeitraum transsituativ begleitet und darüber zeigen kann, wie sich in ihren Kommunikationen ihre Handlungsvorhaben schrittweise entwickeln und entfalten, verändern und Gestalt annehmen. Die für die Gattungsanalyse übliche konversationsanalytische Methode wird entsprechend um ethnographische Verfahren ergänzt. Zudem wird die Verfertigung und Handhabung von Artefakten einbezogen (Skizzen, Notizen, Kalender etc.), sofern sie als kommunikative Ressource eine Rolle spielen. Projektive Gattungen umfassen all die Kommunikationen, die mit ‚planning-in-action‘ verbunden sind. Mit ihrer Analyse ist damit auch eine engere Verknüpfung der Gattungsforschung (bzw. der Sprachsoziologie) mit der Handlungstheorie verbunden. In der Analyse projektiver Gattungen stehen die Akteure und ihre alltäglichen Kommunikationen im Mittelpunkt, die ein Handlungsvorhaben gemeinsam verfolgen und dieses – eben in projektiven Gattungen – kommunikativ bearbeiten. Durch die Analyse projektiver Gattungen lässt sich zeigen, mit welchen Mitteln die Interagierenden ihre (gemeinsame) Zukunft bearbeiten und kommunikativ aushandeln.
------------
**Die Sprache der qualitativen Ungleichheitsforschung: Agency und Handlung in englisch- und deutschsprachigen Publikationen**
**Laura Behrmann** [1], **Falk Eckert** [2]
(1) DZHW, Deutschland; (2) ISF, München
Wissenschaftliches Schreiben ist eine diskursive Praktik und als solche Teil einer Diskursformation welche Relevanz- und Themensetzungen wissenschaftlicher Forschung maßgeblich beeinflusst. Formen der sprachlichen Repräsentation wissenschaftlichen Arbeitens interessieren uns als Konventionen epistemologischer Kulturen (Poferl und Keller 2018) – im Vergleich des englisch und deutschsprachigen Kulturraums (Bethmann und Niermann 2015). Am Beispiel von hochrangigen soziologischen Journalen im Zeitraum von 1995 – 2018 und stellt die diskursive Praktiken und Strategien der Präsentation qualitativer Ungleichheitsforschung im englisch- und deutschsprachigen Raum vor (vgl. Behrmann et. al 2018).
Dabei zeigen unsere Ergebnisse, dass Form und Inhalt auf eigentümliche Art und Weise zusammenspielen. Die objektivierte distanzierte und akkurate Darstellung qualitativer Verfahren im deutschsprachigen Raum verschleiert nicht nur das Subjekt der Forschung sondern auch das Subjekt der Ungleichheitsgenese. Das aktive Forschungssubjekt in den literarischen Präsentationen qualitativer Ungleichheitsforschung des englischsprachigen Raums hingegen ermöglichen die In-Wertsetzung von Agency und alltäglichen Prozessen der Ungleichheitserzeugung.
Aus diesen Ergebnissen resultiert Diskussionsbedarf: Welche Rolle spielen Sagbares und Nicht-Sagbares für die Entwicklung der qualitativen Ungleichheitsforschung in den beiden Sprachräumen? Wo restringieren sprachliche Konvention Inhalte und wo eröffnen sie Möglichkeiten?
Zum einen geben unsere Ergebnisse Anlass die Sprache der wissenschaftlichen Darstellung – die Konventionen und Legitimationen – systematischer zu hinterfragen. Die Untersuchung bietet ein anschauliches Material um die soziale Grammatik der Polarisierung und ihre transformatorischen Dynamiken in den Sozialwissenschaften in Hinblick auf ihre Rückwirkungen auf die qualitative Ungleichheitsforschung zu diskutieren. Zum zweiten bergen kulturspezifisch divergierenden Praktiken für eine zunehmend international operierende Wissenschaft bislang komplett unreflektierte Herausforderungen. Die Übersetzungsleistung, die einer Publikation zu Grunde liegt, ist bis dato komplett unerforscht. Dabei zeigen unsere Ergebnisse auf, dass sowohl in der Erzeugung der Publikation als auch in ihrer Lektüre, kulturspezifische Übersetzungsarbeiten von Nöten sind.
------------
**Zwei Formen subjektiver Beteiligung an sprachlicher Verständigung**
**Matthias Klemm**
Hochschule Fulda, Deutschland
Der Ausdruck "Sprache der Gesellschaft" hebt die soziale Hervorbrachtheit der Sprache ins Bewusstsein. Demnach sind Sprachen evolutionäres Resultat kollektiven Lebens und erst sekundär Vehikel und Ausdruck der Gedankenwelt oder der Mitteilungsabsichten von Individuen. Nimmt man diesen Befund ernst und wendet ihn - wie es etwa Luhmann getan hat - empirisch, dann stellt sich das sprachliche Geschehen zu jedem Zeitpunkt als eines den Individuen (Vor)gegebenes dar - auch für die oder den Sprecher/in, die/der zur eigenen Entäußerung im selben Verhältnis steht wie die im Moment der Äußerung "nur" Zuhörenden.
So gesehen ist sprachliche Verständigung nicht als unmittelbare (intersubjektive) Interaktion von zwei oder mehreren Individuen fassbar, etwa in der Formel, dass Zwei sich miteinander über etwas in der Welt verständigen würden. Vielmehr ist zwischen der je subjektive Beteiligung am sprachlichen Geschehen und der selbstreferenziellen Struktur dieses Geschehens zu unterscheiden. Zu klären ist dann, welche Formen subjektive Beteiligung am sprachlichen Geschehen annehmen kann und worin diese sich von der Beteiligung an anderen genuin sozialen Ereignissen unterscheiden, die durchaus auch einen kommunikativen Charakter haben mögen.

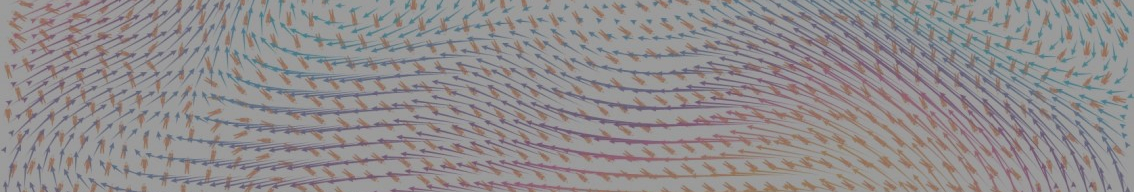

SocioHub Kongressteam ·